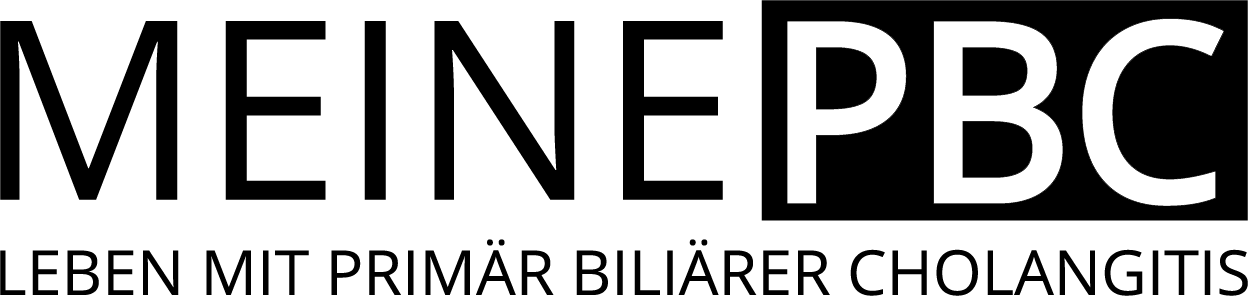Obwohl PBC eine eigenständige Erkrankung ist, tritt sie oft in Verbindung mit anderen Krankheiten auf, insbesondere weiteren Autoimmunerkrankungen. Zum Teil überlappen sich Symptome, sodass nicht immer klar zuzuordnen ist, welche Erkrankung konkret der Auslöser ist. In diesem Blog-Eintrag wollen wir einen Überblick über die häufigsten Erkrankungen geben, die bei Menschen mit PBC diagnostiziert werden, und ihre Zusammenhänge kurz erläutern.
1. Sjögren-Syndrom
Das Sjögren-Syndrom ist eine der häufigsten Begleiterkrankungen bei PBC. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem vor allem die Tränen- und Speicheldrüsen angreift, was zu trockenen Augen und Mundtrockenheit führt. Rund 70 % der PBC-Patienten zeigen Symptome des Sjögren-Syndroms. Diese Überlappung beider Erkrankungen deutet auf gemeinsame immunologische Mechanismen hin, da beide Erkrankungen durch Autoantikörper charakterisiert sind, die gesunde Zellen angreifen.
2. Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen
Patienten mit PBC haben ein erhöhtes Risiko, an Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse zu erkranken, insbesondere an der Hashimoto-Thyreoiditis. Diese Erkrankung führt zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse und kann eine Unterfunktion (Hypothyreose) zur Folge haben. Zwischen 10 und 20 % der PBC-Patienten entwickeln auch eine Hashimoto-Thyreoiditis. Da sowohl PBC als auch Hashimoto-Thyreoiditis Autoimmunerkrankungen sind, ist die gemeinsame Grundlage ein fehlgeleitetes Immunsystem, das gesunde Gewebe angreift.
3. Zöliakie
Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem in Gegenwart von Gluten, einem Protein in Weizen, Roggen und Gerste, den Dünndarm angreift. Bei etwa 5 bis 10 % der PBC-Patienten wird auch eine Zöliakie diagnostiziert. Auch hier gibt es Hinweise auf eine genetische Prädisposition, die beide Erkrankungen verbindet. Die Vermeidung von Gluten in der Ernährung ist die zentrale Maßnahme zur Behandlung der Zöliakie und kann die Lebensqualität von PBC-Patienten erheblich verbessern.
4. Rheumatoide Arthritis
Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, die die Gelenke betrifft. RA tritt bei einigen PBC-Patienten auf, da beide Erkrankungen das Ergebnis von Autoimmunprozessen sind. Während RA primär die Gelenke angreift, kann es bei PBC-Patienten durch systemische Entzündungen zu einer Verstärkung der Symptome kommen. Die Behandlung von RA bei PBC erfordert oft eine engmaschige Betreuung durch mehrere Fachärzte, um die bestmögliche Kontrolle beider Krankheiten zu gewährleisten.
5. Sklerodermie
Sklerodermie ist eine seltene Autoimmunerkrankung, die durch eine Verhärtung und Verdickung des Bindegewebes charakterisiert ist. Etwa 5 % der Patienten mit PBC zeigen Anzeichen von Sklerodermie, insbesondere der limitierten Form, die auch als CREST-Syndrom bekannt ist. Diese Form der Sklerodermie betrifft die Haut, das Gefäßsystem und das Verdauungssystem und kann die Symptome der PBC verschlimmern, indem sie den Fluss der Galle weiter beeinträchtigt.
6. Autoimmune Hepatitis
Autoimmune Hepatitis (AIH) ist eine Entzündung der Leber, die ebenfalls durch eine Fehlfunktion des Immunsystems verursacht wird. In seltenen Fällen kommt es zu einer sogenannten Überlappungssyndrom (Overlap-Syndrom) von PBC und AIH, bei dem sich Symptome und Charakteristika beider Erkrankungen gleichzeitig manifestieren. Diese Konstellation erfordert eine intensive medikamentöse Therapie, um das Fortschreiten der Lebererkrankung zu bremsen.
Fazit
PBC ist eine komplexe Autoimmunerkrankung, die nicht isoliert betrachtet werden kann, da sie oft mit anderen Erkrankungen einhergeht. Die gemeinsame Grundlage von Autoimmunerkrankungen liegt in einer Fehlregulation des Immunsystems, das körpereigenes Gewebe angreift. Patienten mit PBC sollten regelmäßig auf das Vorliegen anderer Autoimmunerkrankungen untersucht werden, um eine ganzheitliche und frühzeitige Behandlung zu ermöglichen. Andere Erkrankungen können auch in Folge von PBC oder unabhängig davon auftreten. Die enge Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Fachbereiche ist entscheidend, um Diagnosen zu stellen, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und das Fortschreiten der Erkrankungen zu verlangsamen.