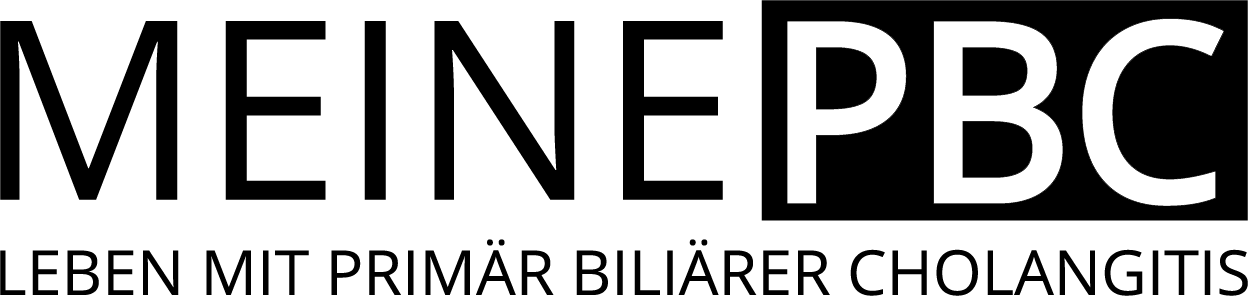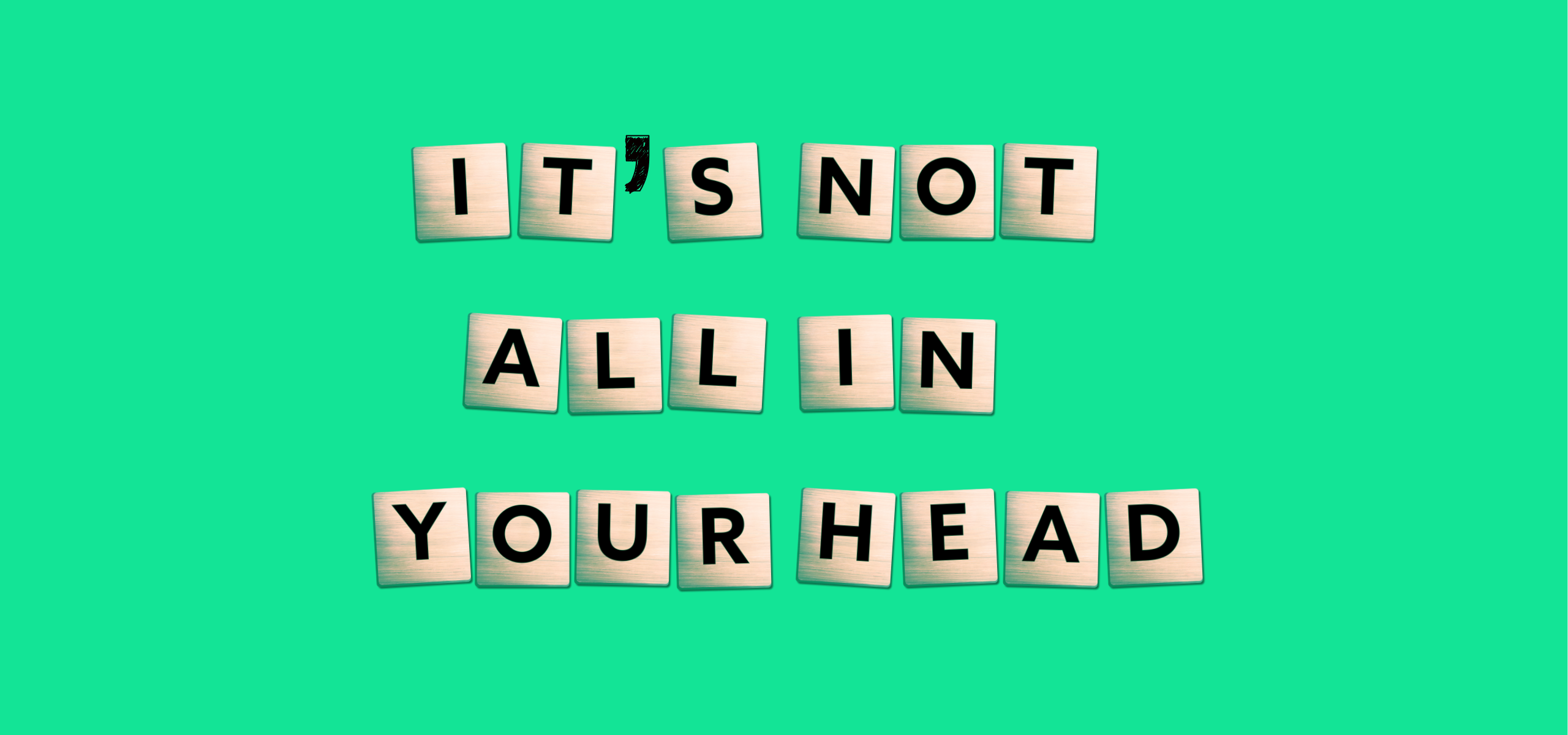Vielleicht hast du das auch schon erlebt: Du gehst mit klaren Beschwerden zum Arzt oder zur Ärztin – Müdigkeit, Juckreiz, Schmerzen – und bekommst zu hören: „Das ist normal in Ihrem Alter“, „Sie sind wahrscheinlich einfach gestresst“, oder sogar „Die Laborwerte sind unauffällig, Sie bilden sich das nur ein.“
Wenn solche Erfahrungen immer wieder vorkommen, spricht man von Medical Gaslighting.
Was bedeutet Medical Gaslighting?
Medical Gaslighting ist ein Begriff für eine Erfahrung, die viele Patient:innen machen: Sie schildern körperliche Symptome oder gesundheitliche Beschwerden – und diese werden systematisch heruntergespielt, angezweifelt oder gar komplett ignoriert. Dabei handelt es sich nicht um ein Missverständnis, sondern um eine Form der Entwertung, die ernsthafte Folgen haben kann.
Der Begriff stammt vom englischen Wort „Gaslighting“, das ursprünglich aus einem Theaterstück kommt, in dem eine Person systematisch manipuliert wird, bis sie an ihrem eigenen Urteilsvermögen zweifelt. Übertragen auf die Medizin bedeutet das: Patient:innen fangen an, sich selbst infrage zu stellen, weil medizinisches Fachpersonal ihre Beschwerden nicht ernst nimmt.
Wie zeigt sich Medical Gaslighting?
Medical Gaslighting kann sich zum Beispiel so äußern:
- Symptome werden als psychisch abgetan, obwohl körperliche Ursachen möglich sind.
- Chronische Beschwerden werden als übertrieben dargestellt oder heruntergespielt.
- Patient:innen hören Aussagen wie „Sie sehen doch gesund aus“, „Andere Frauen machen das auch durch“ oder „Sie sind zu jung für so eine Krankheit“.
- Ärztliche Empfehlungen werden trotz klarer Symptomatik verweigert oder unnötig verzögert.
- Es werden generische Ratschläge gegeben, ohne eine gründliche Anamnese oder Diagnostik durchzuführen. z.B. „Nehmen Sie erstmal ein paar Kilo ab“ oder „Reduzieren Sie Stress“
- Selbst angeeignetes Fachwissen wird systematisch abgesprochen.
Gerade bei Krankheiten wie PBC, die oft schleichend beginnen, sind Betroffene besonders gefährdet, nicht ernst genommen zu werden – besonders dann, wenn sie weiblich sind.
Warum ist das gefährlich?
Wenn Beschwerden ignoriert oder nicht richtig eingeordnet werden, verzögert sich die Diagnose – mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Gerade bei Autoimmunerkrankungen wie PBC kann eine frühe Diagnose entscheidend sein, um das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen.
Zudem kann Medical Gaslighting das Vertrauen in das Gesundheitssystem erschüttern. Viele Betroffene trauen sich nach solchen Erfahrungen nicht mehr, über ihre Symptome zu sprechen – oder vermeiden Arztbesuche ganz. Das kann zu einer unnötigen Verschlechterung der Gesundheit führen.
Warum besonders Frauen betroffen sind
Studien und Erfahrungsberichte zeigen deutlich: Frauen sind besonders häufig von Medical Gaslighting betroffen. Das hat mehrere Gründe:
- Geschlechtsspezifische Vorurteile: In der Medizin gibt es nach wie vor stereotype Annahmen darüber, wie Männer und Frauen Schmerzen oder Beschwerden empfinden. Frauen wird häufiger unterstellt, sie seien „überempfindlich“, „hysterisch“ oder „emotional“ – und ihre Symptome würden eher auf Stress oder psychische Ursachen zurückgeführt als bei Männern.
- Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen: Viele Autoimmunerkrankungen – wie die Primär Biliäre Cholangitis (PBC) – treten deutlich häufiger bei Frauen auf. Da diese Erkrankungen oft unspezifisch beginnen, kann es sein, dass Betroffene erst nach Jahren eine richtige Diagnose erhalten – wenn überhaupt.
- Symptome, die nicht sichtbar sind: Erschöpfung, Juckreiz, Gelenkschmerzen oder Konzentrationsprobleme sind typische Symptome bei PBC – aber sie sind äußerlich nicht erkennbar. Das führt dazu, dass Frauen mit solchen Beschwerden oft mit Sätzen wie „Sie sehen doch gesund aus“ oder „Das ist bestimmt nur die Psyche“ abgefertigt werden.
Das Ergebnis: Viele Frauen zweifeln irgendwann an sich selbst, zögern Arztbesuche hinaus oder resignieren völlig. Medical Gaslighting kann also nicht nur die körperliche Gesundheit beeinträchtigen, sondern auch das Selbstvertrauen und die mentale Stärke untergraben.
Wie auch in der Arbeitswelt oder allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, müssen Frauen allzuoft ihren Wert „beweisen“ und dafür kämpfen, gehört zu werden. Dies gilt ebenso für alle marginalisierten Gruppen wie z.B. People of Colour und queere Personen.
Warum die medizinische Forschung Frauen oft nicht ausreichend berücksichtigt
Ein weiterer Grund, warum Frauen – und damit auch viele Patientinnen mit Autoimmunerkrankungen wie PBC – häufiger unter Medical Gaslighting leiden, liegt in der Geschlechterverzerrung in der medizinischen Forschung.
Die meisten medizinischen Studien wurden und werden bis heute überwiegend an weißen, männlichen Probanden durchgeführt. Das betrifft sowohl klinische Studien für Medikamente als auch grundlegende Forschung zu Symptomen, Krankheitsverläufen oder Diagnosekriterien.
Die Folgen:
- Krankheiten äußern sich bei Frauen oft anders – aber diese Unterschiede werden nicht ausreichend erforscht oder erkannt.
- Symptome, die bei Männern typisch sind, gelten als „Standard“. Wenn Frauen andere Beschwerden haben, gelten sie schnell als „unklar“ oder „nicht objektivierbar“.
- Medikamente werden häufig nach der Wirkung im männlichen Körper entwickelt. Das kann bei Frauen zu falscher Dosierung oder unerwarteten Nebenwirkungen führen.
Gerade bei chronischen oder autoimmunen Erkrankungen – wie PBC – ist das ein echtes Problem. Obwohl Frauen hier deutlich häufiger betroffen sind, mangelt es an geschlechtersensibler Forschung und Versorgung.
Diese strukturellen Lücken in der Wissenschaft tragen dazu bei, dass die Beschwerden vieler Frauen nicht ernst genommen werden – weil sie nicht in das vermeintlich „normale“ medizinische Bild passen. Medical Gaslighting ist also nicht nur ein individuelles, sondern auch ein systemisches Problem. Das Gesundheitssystem ist leider noch immer stark patriarchalisch geprägt und diskriminiert (bewusst und unbewusst) Menschen, die nicht männlich, weiß und heterosexuell sind.
Was kannst du tun, wenn du betroffen bist?
Hier ein paar Tipps, wie du dich schützen kannst:
- Führe ein Symptom-Tagebuch: Notiere dir genau, was du wann spürst. Das hilft dir, deine Beschwerden nachvollziehbar quantitativ und qualitativ zu schildern. Wenn du bereits Befunde, Arztbriefe etc. hast, nimmt sie gut sortiert mit zum Termin.
- Hole dir eine Zweitmeinung: Wenn du dich nicht ernst genommen fühlst, darfst du dir eine andere ärztliche Meinung einholen. Manchmal stimmt einfach der Vibe nicht. Du bist nicht verpflichtet, dich von behandeln zu lassen, wenn du dich nicht wohl fühlst.
- Bestehe auf deiner individuellen Erfahrung: Du kennst deinen Körper am besten. Lass dich nicht verunsichern. Wichtig ist nicht, wie andere Menschen mit Beschwerden umgehen, sondern wie du sie empfindest.
- Suche Austausch mit Gleichgesinnten: In Selbsthilfegruppen, Foren oder Communities findest du Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
- Unterstützung beim Termin: Nimm eine vertraute Person mit zum Arzttermin, insbesondere, wenn du den Arzt oder die Ärztin noch nicht kennst. Es macht oft einen sehr großen Unterschied, in der Ärzt:innen-Patient:innen-Kommunikation, wenn eine dritte Person im Raum ist.
- Sprich darüber: Wenn du negative Erfahrungen machst, solltest du diese nicht einfach schlucken. Manchmal kann es helfen, mit den Behandelnden direkt das Gespräch zu suchen. Oft sind diese aber leider nicht einsichtig. Bei vielen Einrichtungen wie Kliniken oder MVZ gibt es aber z.B. die Möglichkeit, Feedback für das interne Qualitätsmanagement einzureichen.
Fazit
Medical Gaslighting ist real – und es trifft überdurchschnittlich oft Frauen und Menschen aus marginalisierten Personengruppen. Wenn du den Verdacht hast, dass dir so etwas passiert, sprich darüber. Mit anderen Betroffenen. Mit Menschen, denen du vertraust. Oder auch öffentlich. Und vor allem: Gib nicht auf. Deine Symptome sind echt. Und du verdienst es, gehört und behandelt zu werden.