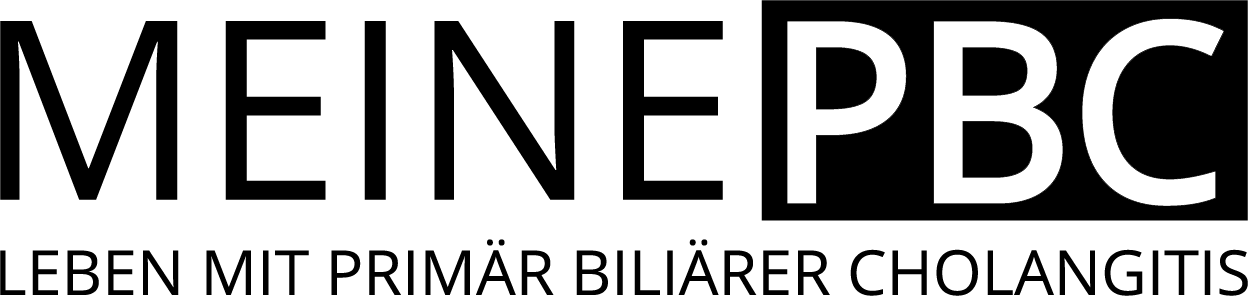Wenn man von einer chronischen Erkrankung hört, denkt man meistens erstmal an die gesundheitlichen Aspekte, z.B. in Form von Symptomen wie Schmerzen, Müdigkeit, Einschränkungen im Alltag oder häufige Arztbesuche. Was jedoch selten im Fokus steht, aber für Betroffene meist ebenso belastend ist, sind die finanziellen Folgen.
Denn eine chronische Erkrankung betrifft nicht nur Körper und Seele, sondern auch den Geldbeutel – und zwar dauerhaft. Das kann so weit gehen, dass man trotz Krankheit nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell am Limit lebt.
Weniger Arbeit, weniger Einkommen
Wer häufig krank ist und im Job fehlt, dem droht vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes. Nicht überall lassen sich Aufgaben und Arbeitsmittel an die besonderen Herausforderungen einer chronischen Erkrankung anpassen.
Viele Menschen mit einer chronischen Erkrankung merken irgendwann, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind wie früher. Müdigkeit, Schmerzen oder andere Symptome machen es dann unmöglich, Vollzeit zu arbeiten. Manche reduzieren ihre Stunden – mit allen Konsequenzen: Weniger Arbeitszeit bedeutet weniger Geld. Nicht nur heute in Form des Gehalts, sondern auch später als Rente.
Ein Ausgleich kann die Teilerwerbsminderungsrente sein, die gewährt wird, wenn gutachterlich festgestellt wird, dass man aufgrund der Erkrankung dauerhaft mehr als 3, aber weniger als 6 Stunden pro Tag arbeiten kann. Wer gar nicht mehr arbeiten kann bzw. nur bis zu 3 Stunden am Tag, erhält die volle Erwerbsminderungsrente. Der Weg bis zur Gewährung kann allerdings mitunter sehr langwierig und belastend sein und die Höhe entspricht natürlich nicht annähernd dem, was man zuvor durch Erwerbsarbeit eingenommen hat. Während das Leben durch die Krankheit teurer wird, sinkt also das Einkommen deutlich.
Das bedeutet konkret zum Beispiel:
- Man kann seinen bisherigen Lebensstandard nicht mehr halten.
- Urlaube oder Freizeitaktivitäten, die sonst für Ausgleich gesorgt haben, fallen weg.
- Gesunde Ernährung wird zur Herausforderung.
- Schon kleine ungeplante Ausgaben können zur Katastrophe werden.
- Vielleicht verliert man sogar die Wohnung, weil die Miete nicht mehr zu stemmen ist, und muss in eine andere Umgebung ziehen.
- Soziale Kontakte werden eingeschränkt, weil man sich Aktivitäten mit Freund:innen nicht mehr leisten kann.
Ein Leben, das ohnehin schon von Einschränkungen geprägt ist, wird dadurch zusätzlich unsicher.
Medizinische Kosten, die nicht übernommen werden
Die Krankenkassen übernehmen in Deutschland zwar viel, aber längst nicht alles. Gerade bei chronischen Krankheiten zeigen sich hier schnell die Grenzen:
- Medikamente: Manche Präparate sind nicht verschreibungsfähig, auch wenn sie nachweislich helfen. Diese müssen komplett selbst bezahlt werden.
- Zuzahlungen: Für Medikamente, Hilfsmittel oder Therapien fallen oft Zuzahlungen an – gerade bei langwierigen Erkrankungen summiert sich das.
- Vitamine und Mineralstoffe: Liegt ein Mangel vor, übernimmt die Krankenkasse manchmal nur die Laborkontrolle, nicht aber die Präparate. Vitamin D, Magnesium, Selen, Zink & Co. müssen daher häufig selbst gekauft werden.
- Hilfsmittel: Von Gehhilfen über spezielle Kissen bis zu orthopädischen Matratzen – oft zahlt die Kasse nur die „Basisversion“ oder nichts, weil die Notwendigkeit nicht medizinisch belegbar ist. Wer etwas wirklich Passendes und damit alltagstaugliches braucht, muss draufzahlen.
- Umbauten zu Hause: Wenn das Badezimmer barrierefrei werden muss oder eine Treppe nur noch mit Lift bewältigt werden kann, geht es schnell um mehrere tausend Euro. Ein Zuschuss ist manchmal möglich, aber längst nicht immer ausreichend.
Was viele nicht wissen: Diese Kosten laufen nicht einmalig auf, sondern oft Monat für Monat – ein Dauerposten, der das Haushaltsbudget spürbar belastet.
Therapien und Symptommanagement
Medizin endet nicht bei Tabletten. Viele chronisch Kranke wissen: Nur mit zusätzlicher Unterstützung lassen sich die Symptome erträglicher machen. Doch die Maßnahmen, die das Leben erträglicher machen, muss man fast immer selbst zahlen.
Hier ein paar Beispiele:
- Massagen können Verspannungen und Schmerzen lindern.
- Osteopathie hilft vielen bei Verdauungs- oder Bewegungsproblemen.
- Akupunktur kann Schmerzen oder Übelkeit reduzieren.
- Cremes, Salben oder spezielle Hautpflege sind oft unverzichtbar z.B. bei PBC-bedingtem Juckreiz, wenn Medikamente Nebenwirkungen wie Hautausschläge verursachen.
- Entspannungskurse, Meditation oder Yoga sind sinnvoll – aber meist ebenfalls kostenpflichtig.
- Angepasste Ernährung ist für viele chronisch kranke eine wichtige Stellschraube, um Symptome zu minimieren. Spezial-Produkte kosten aber oft ein vielfaches (glutenfrei, laktosefrei, Diabetikergeeignet etc.).
All das sind laufende Kosten, die man unmittelbar im Geldbeutel spürt. Für Menschen, die ohnehin schon weniger Einkommen haben, bedeutet das oft harte Entscheidungen: „Zahle ich meine Stromrechnung oder gönne ich mir die Massage, die meine Schmerzen lindert?“
Die Folgen: Stress, Sorgen und noch mehr Krankheit
Finanzielle Unsicherheit ist für die Psyche extrem belastend. Wer nicht weiß, ob das Geld am Monatsende reicht, spürt einen ständigen Druck. Dazu kommt die Angst vor unerwarteten Ausgaben: „Was, wenn mein Kühlschrank kaputtgeht? Was, wenn ich plötzlich ein neues Hilfsmittel brauche?“
Das Bittere: Dieser Stress bleibt nicht ohne Folgen für die Gesundheit. Dauerhafte Sorgen erhöhen die Belastung des Körpers, verschlechtern das Immunsystem und können die Symptome der Grunderkrankung verschärfen. Ein Teufelskreis entsteht: Die Krankheit verursacht finanzielle Probleme, die wiederum die Krankheit verschlimmern.
Wo finde ich Unterstützung?
Niemand sollte mit den finanziellen Belastungen einer chronischen Erkrankung allein dastehen. Auch wenn es manchmal mühsam ist, durch den Dschungel an Formularen und Zuständigkeiten zu navigieren – es gibt Stellen, die Hilfe anbieten können:
- Sozialdienste in Kliniken und Reha-Einrichtungen
Dort arbeiten Fachkräfte, die bei Anträgen für Reha-Maßnahmen, Hilfsmittel oder Pflegegrade unterstützen. Sie kennen die Wege und Fristen und können gezielt beraten. - Sozialverbände (z. B. VdK, SoVD)
Diese Organisationen bieten Rechtsberatung und Unterstützung beim Durchsetzen von Ansprüchen gegenüber Krankenkassen, Rentenversicherungen oder Ämtern. Oft kann eine Mitgliedschaft viel Stress ersparen. - Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen
Hier bekommt man nicht nur Informationen über den Umgang mit der Erkrankung, sondern auch Tipps, welche Kosten übernommen werden können und wo man Zuschüsse beantragen sollte. - Krankenkassen
Viele Krankenkassen bieten Bonusprogramme oder übernehmen anteilig die Kosten für Gesundheitskurse, Hilfsmittel oder bestimmte Behandlungen. Ein Anruf bei der Kasse lohnt sich oft. - Pflegegrad oder Grad der Behinderung beantragen
Wer dauerhaft Unterstützung braucht, sollte prüfen, ob ein Pflegegrad in Frage kommt. Auch bei nicht-bettlägerigen Patient:innen können dadurch finanzielle Leistungen oder Hilfsmittel bezuschusst werden. Je nach Grad der Behinderung werden Steuerfreibeträge gewährt (schon ab GdB 20). - Stiftungen und Fonds
Es gibt verschiedene Stiftungen, die in besonderen Härtefällen finanzielle Unterstützung leisten. Hier lohnt es sich, gezielt nach krankheitsspezifischen Fonds oder regionalen Angeboten zu suchen.
Fazit
Chronisch krank zu sein bedeutet nicht nur, medizinische und körperliche Herausforderungen zu meistern. Es bedeutet auch, mit einem ständigen finanziellen Druck zu leben, der das Leben zusätzlich erschwert.
Es braucht dringend mehr Bewusstsein dafür – in der Gesellschaft, in der Politik und im Gesundheitssystem. Denn Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Und wer krank ist, sollte nicht auch noch die Angst haben müssen, durch die Erkrankung finanziell ins Aus gedrängt zu werden.